Im Gerichtssaal von Santa Maria Capua di Vetere wird der Mord an sechs Afrikanern verhandelt, die im September 2008 in Castel Volturno von einem mit Maschinenpistolen bewaffneten Killerkommando ermordet wurden. Angeklagt sind sechs Angehörige des Clans der Casalesi – jenes Camorra-Clans aus Casal di Principe, den Roberto Saviano in seinem Buch Gomorrah beschrieb. Rosaria Capacchione war eine der Ersten am Tatort. Mit dem Massaker an den Afrikanern wollten die Casalesi ein weiteres Mal beweisen, wer die Kontrolle über diesen Landstrich unweit von Neapel hat, wo die Berge von Steinbrüchen aufgefressen werden und ein Höllenpfuhl entstanden ist voller Einkaufszentren, Parkplätze und nigerianischer Prostituierter, die zwischen umherwehenden Plastikfetzen, Metallgerümpel und Glassplittern auf Freier warten.
Seit zwanzig Jahren arbeitet Rosaria Capacchione als Gerichtsreporterin für die neapolitanische Tageszeitung Il Mattino in der Redaktion von Caserta. Sie weiß, wo die Casalesi ihr Geld waschen. Und dass sie mit Vorliebe Socken von Brioni tragen, im Farbton Londoner Grau. Sie weiß, welcher Clan mit wem Allianzen schmiedet, welcher Camorrista mit welchem Politiker befreundet ist und wie Müll zu Gold wird. L’Oro della Camorra heißt auch ihr 2008 erschienenes Buch, in dem sie die Verbrechen der Casalesi akribisch mit Fußnoten belegt.
Als Rosaria am Ende der Verhandlung in der Bar des Gerichts ein vertrauliches Gespräch mit einem Mafiaanwalt führt, spricht sie mit ihm wie mit einem schlecht erzogenen Kind. Dicht neben Rosaria steht eine Frau, die an ihr klebt wie eine etwas neugierige Freundin. Sie trägt ein Piercing an der Unterlippe und weicht selbst dann nicht von ihrer Seite, als der Anwalt der Reporterin vertraulich etwas ins Ohr zu raunen versucht.
Vor eineinhalb Jahren kündigten die Camorristi an, die Journalistin für ihre Enthüllungen bezahlen zu lassen, seitdem wird sie bei jedem Schritt von zwei Polizisten begleitet. Heute sind es ein grauhaariger, durchtrainierter Mann – und die Frau mit dem Piercing. Wenn Rosaria in der Redaktion arbeitet, warten ihre Leibwächter unten auf der Straße. Vor Mitternacht verlässt Rosaria selten die Redaktion; heute will sie noch zwei Artikel über die Angehörigen der Opfer schreiben.
Ihr Büro ist mönchisch kahl, vom Schreibtisch blickt sie auf einen Aktenschrank. Daran hängt ein Blatt mit »Nützlichen Anweisungen für Journalistenkollegen, die auf eine Unterredung mit Rosaria Capacchione warten«. »Die C. schläft lange und läuft erst am Nachmittag auf Hochtouren«, heißt einer der Ratschläge. Oder: »Die C. darf nicht im Profil fotografiert werden.« Oder: »Die C. mag es nicht, wenn man ihr widerspricht.« Als Rosaria Capacchione bedroht wurde und Leibwächter bekam, wurde sie selbst zum Gegenstand der Berichterstattung. Jedes Mal, wenn das berühmte TV-Politikmagazin Annozero auf Rai Due von den Machenschaften der Casalesi berichtet, wird Rosaria Capacchione interviewt, kettenrauchend an ihrem Schreibtisch in der Redaktion sitzend.
Sie habe eine laizistische Einstellung zu ihrem Beruf, sagt Rosaria kühl. Sie führe keinen Krieg gegen die Mafia, sondern schreibe nur auf, was sie wisse. Und das ist, nach zwanzig Jahren, nicht wenig. Oft weiß sie mehr als die Staatsanwälte, von denen viele hier nur so lange arbeiten, bis es ihnen gelingt, sich wieder versetzen lassen. »Man sagt von mir, dass ich böse sei«, sagt Rosaria. »Aber ich mache nichts anderes, als zu informieren. Dinge zusammenzufügen.« Und genau das fürchtet die Camorra.
Rosaria lebt allein, hat keine Kinder – aber fünf Geschwister, die samt Schwagern und Schwägerinnen, Nichten und Neffen über sie wachen wie eine Löwenfamilie. Niemand habe je zu ihr gesagt: Hör auf damit! Weder ihre Geschwister noch ihre Freunde. Auch keiner ihrer Kollegen. »Weil ich sie sonst von der Liste gestrichen hätte«, sagt Rosaria.
Unlängst hat man bei ihr eingebrochen. Gestohlen wurde nichts – außer einem Preis, den sie für ihre Antimafia-Berichterstattung erhalten hat. Der Einbruch ist eine Botschaft: Wir könnten, wenn wir nur wollten. In der Eigentümerversammlung sorgte sich ein Hausbewohner über eine etwaige Wertminderung der Wohnungen wegen der von der Mafia bedrohten Nachbarin.
»Ein von der Mafia bedrohter Journalist ist vor allem eines: allein.« Sagt Alberto Spampinato, Gründer des Nationalen Observatoriums für verheimlichte Nachrichten und bedrohte Journalisten. Spampinato ist Redakteur der Nachrichtenagentur Ansa – und ein Bruder des 1972 von der Mafia ermordeten Journalisten Giovanni Spampinato. In den letzten 30 Jahren ermordete die Mafia in Italien 13 Journalisten.
Die Ersten, die einem von der Mafia bedrohten Reporter in den Rücken fielen, seien dessen Kollegen, sagt Alberto Spampinato. Stets sei jemand zur Stelle, der beweisen möchte, dass der Journalist fehlerhaft über die Mafia schreibe. Immer rede einer die Folgen der Bedrohung klein und rechne sie auf gegen den Vorteil, bekannt zu werden. »Unvorsichtig« sei der Kollege gewesen, nur aus Eitelkeit habe er jenen stillschweigenden Pakt verletzt, der darin bestehe, bestimmte Nachrichten zu unterdrücken. Vor allem in Süditalien sind immer noch unzählige Zeitungen bereit, sich als Sprachrohr der Bosse zu betätigen.
»Jeder, der über die Mafia schreibt, tut das auf eigene Gefahr«, sagt Alberto Spampinato. In den letzten drei Jahren wurden mehr als zweihundert Journalisten in Italien von der Mafia bedroht – nicht nur mit Brandsätzen und unverhüllten Morddrohungen, sondern auch ganz legal: mit Verleumdungsklagen und astronomischen Schadensersatzforderungen, die Journalisten einschüchtern sollen. Oder wie es der Politikwissenschaftler Claudio Riolo nennt: »Einen treffen, um Hunderte zu erziehen.«
Riolo blickt auf eine kafkaeske, 15 Jahre währende Prozessgeschichte zurück. 1994 schrieb er für eine Antimafia-Zeitschrift einen Artikel über den Strafverteidiger Francesco Musotto, damals Präsident der Provinz Palermo. Der hatte es fertiggebracht, im Prozess gegen die Attentäter von Staatsanwalt Giovanni Falcone gleichzeitig als Opfer und als Verteidiger aufzutreten: Einerseits vertrat Musotto die Provinz Palermo als Geschädigte, andererseits verteidigte er einen der angeklagten Mafiabosse. Der eigentümliche Fall von Anwalt Musotto und Mister Hyde hieß Riolos Artikel. Fünf Monate nach dessen Erscheinen strengte Musotto eine Verleumdungsklage an und forderte 350.000 Euro Entschädigung. Sechs Jahre dauerte der Prozess in der ersten Instanz – am Ende wurde der Politikwissenschaftler Riolo schuldig gesprochen und zu einer Zahlung von 70.000 Euro verurteilt. Anders als bei Strafprozessen ist das Urteil eines Zivilprozesses sofort gültig: Das Gericht verfügte, ein Fünftel des Gehalts des Politikwissenschaftlers zu pfänden – eine Pfändung, die auch für seine in einigen Jahren einsetzende Pension gilt.
In den beiden folgenden Instanzen wurde das Urteil bestätigt; am Ende des zwölf Jahre dauernden Verfahrens wurde Riolo auch vom Kassationsgericht für schuldig befunden. Doch dann geschah, was in Italien noch nie geschehen war: Riolo legte beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung ein – und gewann. Im Prozess »Riolo gegen Italien« wurde der Staat für schuldig befunden, die Meinungsfreiheit nicht geschützt zu haben. Der Artikel über den Mafiaanwalt sei keine Verleumdung gewesen, sondern eine mit Fakten belegte, für demokratische Staaten zulässige Meinungsäußerung. Im Oktober vergangenen Jahres wurde Italien zur Zahlung einer Entschädigung von 72.000 Euro verurteilt. Da das europäische Urteil das italienische nicht außer Kraft setzt, sondern nur ergänzt, trägt nun der italienische Staat die Kosten für die vermeintliche Verleumdung des Mafiaanwalts. Ironie der Justiz. Eines aber haben selbst italienische Mafiajournalisten noch nicht gesehen: geschwärzte Seiten in einem Mafiabuch. Deshalb berichteten die italienischen Medien auch ausgiebig darüber, dass mein Buch Mafia. Von Paten, Pizzerien und falschen Priestern in Deutschland nur zensiert erscheinen darf. Dem Erfurter Gastronomen Spartaco Pitanti und dem Duisburger Hotelier Antonio Pelle ist es mit einer einstweiligen Verfügung gelungen, die sie betreffenden Passagen schwärzen zu lassen.
»Die Autorin nennt Namen, die bestens bekannt sind, da sie nicht nur in den Ermittlungsunterlagen sowohl der deutschen als auch der italienischen Polizei auftauchen, sondern auch in Justizakten und in zahlreichen journalistischen Berichten. Wenn wir von verdächtigen Personen nicht mehr sprechen dürfen, soll das Volk das Problem wohl weiterhin ignorieren, soll das Gemetzel von Duisburg als Zwischenfall der Geschichte durchgehen, von dem man sich schnell erholt, um sich wieder oberflächlichem Gerede und unwesentlichen Problemen zu widmen. Hoffen wir, dass es kein bitteres Erwachen gibt.« Das schrieb der nationale Antimafia-Staatsanwalt Vincenzo Macrì in dem Vorwort zu meinem Buch. Es ist inzwischen auch in Italien erschienen, unter dem Titel Santa Mafia, »Heilige Mafia«. Einer der ersten Leser war Marcello Dell’Utri, der als »Gehilfe der Mafia« in erster Instanz zu neun Jahren Haft verurteilte Senator, Gründer von Forza Italia und rechte Hand des italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi. Umgehend kündigte er eine Klage gegen mein Buch an.
Kurz nachdem mein Buch in Deutschland geschwärzt wurde, veröffentlichte Jürgen Roth sein Buch Mafialand Deutschland . Kaum erschienen, wurde auch in seinem Fall einer einstweiligen Verfügung stattgegeben: Der in Leipzig tätige Kellner Pasquale Serio setzte vor dem Landgericht Leipzig die Schwärzung der ihn betreffenden Passagen durch. Und im November dieses Jahres versuchte Domenico Giorgi, ein in Erfurt tätiger Gastronom und Geschäftsfreund meines Klägers Spartaco Pitanti, ebenfalls eine Unterlassungserklärung gegen Roths Buch zu erreichen. Allerdings vergeblich. Das Leipziger Gericht wies das Ansinnen ab.
Das hielt Giorgis Anwalt nicht davon ab, bundesweit Abmahnungen an alle Buchhandlungen zu schicken und juristische Konsequenzen anzudrohen, falls sie Roths Buch verkaufen würden. Zeitgleich verklagten die beiden Erfurter Gastronomen Pitanti und Giorgi einen Journalisten des italienischen Wochenmagazins L’espresso, der im März 2009 einen Artikel über die Mafia in Deutschland veröffentlicht hatte. Für die »Verleumdung in besonders schwerer Form« forderte der Anwalt die stattliche Entschädigungssumme von 518.000 Euro. Einen treffen und Hunderte erziehen: Der Verleger wird sich fragen, ob er ein Mafiabuch überhaupt verlegen soll. Der Journalist wird sich fragen, ob er bei seinem nächsten Artikel wirklich Namen nennt. Chi me lo fa fare? Wie komme ich dazu? Denn: Wie soll ich meine Anwaltskosten bezahlen?
Francesco Saverio Alessio hat ein Buch geschrieben, das die Verbindungen zwischen der kalabrischen ’Ndrangheta, der kampanischen Camorra und den Freimaurern aufdeckt. Seitdem wird er bedroht, verklagt, beleidigt, eingeschüchtert. Bei einer Antimafia-Veranstaltung schrie er seine Wut heraus: »Und wenn ihr mich umbringt, ihr erbärmlichen Scheißkerle, verkauft sich unser Buch drei Millionen Mal!«
Andere Journalisten retten sich in Ironie. Giacomo di Girolamo ist Chefredakteur des Lokalradios RMC 101 in Marsala, wo Sizilien ganz nah an Afrika rückt, das Licht gleißend ist und die Häuser ockerfarbene Würfel sind. Und wo alle zwei Wochen eine Bar, eine Werkstatt, ein Geschäft angezündet wird, weil der Besitzer nicht genügend Schutzgeld bezahlt hat. Giacomo wagt es, darüber zu berichten – und sein Auto wurde zerkratzt, bespuckt und aufgebrochen. Seitdem fährt er Rad – drei Fahrräder wurden ihm schon geklaut. Eines Abends tauchte jemand vor Giacomo auf, der ihm etwas zunuschelte. »Es war dunkel und regnete«, erzählt der Journalist, »und ich habe nur verstanden, dass ich auf ihn hören sollte. Aber nicht, warum.«
Ein anderes Mal wurde ein Fotograf gleichen Namens am Telefon bedroht, ein Versehen. Zuletzt wurde die Kanzlei in der Etage über dem Radiostudio in Brand gesteckt – offenbar hatten sich die Brandstifter in der Etage geirrt. »Wenn ich mir das ansehe, sieht es schlecht aus für die Mafia«, sagt Giacomo di Girolamo. »Drei Drohungen, und keine davon haben sie richtig hingekriegt.«
Er legt den Matteo, wo bist du? -Jingle ein und kündigt so jedes Mal die neuesten Nachrichten über jenen Mafiaboss Matteo Messina Denaro an, der die Gegend um Marsala beherrscht und seit 16 Jahren flüchtig ist. An diesem Tag ist ein dem Boss nahestehender Clan verhaftet worden, der im Wesentlichen aus drei Achtzigjährigen und zwei Frauen bestand. In der Lokalzeitung wird der Polizeichef von allen Honoratioren der Stadt zur Festnahme beglückwünscht. »Komisch eigentlich«, sagt Girolamo, »an Tagen wie diesem kommt man sich vor wie auf einer Hochzeit, wenn sich niemand vorwerfen lassen will, kein Glückwunschtelegramm geschickt zu haben.« Dann kündigt er ein Interview mit einem Stadtrat an, der gleichzeitig Regionalassistent für Legalität und Anwalt eines Mafioso ist.
»Ich kann hier nichts verändern«, sagt Girolamo. »Aber ich muss es erzählen. Damit niemand sagen kann, er hätte nichts gewusst.«
Petra Reski
http://www.zeit.de/2010/05/Mafia-Journalisten?page=all
Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter
www.zeit.de/audio
Die Mörder, die Mafiosi, die Politiker, die Freimaurer haben Angst vor unseren Worten, Italien, Mafia
Francesco Saverio Alessio
Karriere-Preisträger der sechsten Verleihung des italienischen Philosophiepreises 2012 in Certaldo (Florenz)
Gegen die ’Ndrangheta. Ein Interview zwischen Deutschland und Italien
DEMONI E SANGUE
'ndrangheta un potere glocale e invisibile
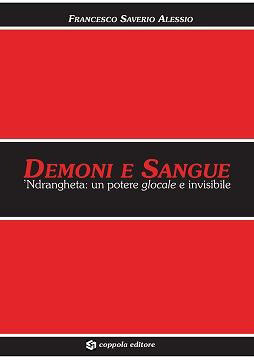
Gegen
die ?Ndrangheta. Ein Interview zwischen Deutschland und Italien.
Francesco Saverio Alessio ist ein kalabrischer Schriftsteller. Er hatte den Mut, die Stimme
gegen die ?Ndrangheta zu heben, sein Land zu verteidigen. Er wagte zu hoffen. Es war eine Lebensentscheidung, fr die er heute noch einen hohen Preis zahlt.
Und doch gibt er nicht auf.